Ambivalenz des Zeiterlebens
„Dauern und Verfließen ist formal ein und dasselbe, und doch verkehrt sich vom einen zum andern der gelebte Sinn“ – (Friedrich Kümmel) –
Alles Geschehen bringt Veränderung. Etwas entsteht auf Kosten von etwas anderem, das vergeht. Entstehen und Vergehen sind mit einander verknüpft wie zwei Seiten einer Münze. Das eine ist nicht ohne das andere zu haben.
Veränderung und Geschehen als solches werden erst benennbar, wenn unter zufällig gegebenen Umständen differierende Zustände eines Davor und eines Danach unterschieden und artikuliert werden können. Die vielfältigen Möglichkeiten, diese Unterscheidung sprachlich zum Ausdruck zu bringen, sind kulturell geprägte, sozial tradierte und individuell im Zuge der Sozialisation erlernte Kompetenzen, die menschliche Gesellschaften nach dem heutigen Stand der historischen Forschung vor etwa Drei- bis Fünftausend Jahren in verschiedenen, oft wechselseitig beeinflussten Entwicklungslinien allmählich erworben haben.
Diese, im heutigen Verständnis zeitliche Auslegung situativen Geschehens ist weder notwendig noch selbstverständlich. Es gab und gibt (?) Traditionen, die das wahrgenommene, veränderliche Erscheinungsbild der Welt als wechselnde Aspekte oder Perspektiven ganzheitlicher Gegebenheiten verstanden haben. Die eine unveränderliche Welt entgleitet dann nicht in fortschreitendem jahreszeitlich geprägten Wandel, sondern zeigt sich im regelmäßig wechselnden Kleid von Jahreszeiten in variablen Ausprägungen.
Die Unterscheidung eines Davor und eines Danach geht einher mit dem Verlust der Einheit des Geschehens. Das ambivalente Sowohl-als-auch der kontingenten Umstände wird antinomisch in ein kategorisch unterschiedenes Entweder-oder von Entstehen und Vergehen aufgespalten: Aus in Variationen sich wiederholenden Gegebenheiten wird eine schwindsüchtige Flüchtigkeit, die ohne Unterlass aus einem Nicht-mehr in ein Noch-nicht strebt oder umgekehrt, aus einem Noch-nicht in ein Nicht-mehr entschwindet. Ein unbeständiges, vom Nichtsein flankiertes Sein, das je nach Befindlichkeit und Interessenlage hoffnungsvoll als konstruktiv oder schicksalsergeben als destruktiv erlebt wird.
Alles Schaffen ist mit Zerstörung verbunden, jede Konstruktion wird von Destruktion begleitet, jedes Entstehen geht mit einem Vergehen einher, jede Errungenschaft mit einem Verlust. Der Bau eines Tempels erfordert Materialentnahme aus der Umwelt und hinterlässt Verwüstungen in einer gewachsenen Naturlandschaft. Der moderne, in okzidental geprägten Gesellschaften lebende Mensch neigt dazu, sich durch strikte zeitliche Strukturierung seiner Weltvorstellungen eine Illusion der kontrollierten Planbarkeit seiner konstruktiven Bestrebungen zu verschaffen. Er kann diese Illusion aufrecht erhalten, indem er die destruktive Seite seiner Aktivitäten systematisch ausblendet oder, wenn nötig, flexibel orientiert am eigenen Vorteil umdeutet und in seine konstruktiven Bestrebungen integriert.
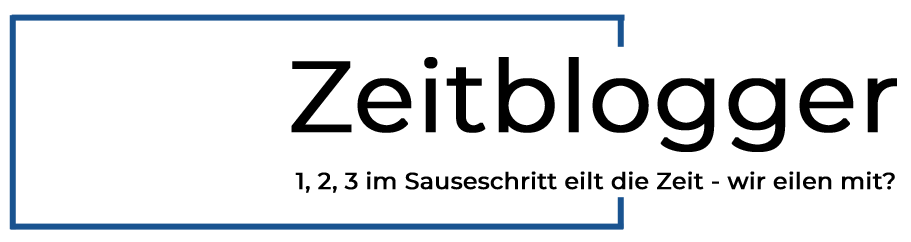
Schreibe einen Kommentar