Friedrich Kümmel
Im Zentrum von Kümmels Überlegungen steht die zeitliche Bewältigung von Wandel und Veränderung, die in der Gegenwart vollzogen werden muss, denn, so Kümmel, was immer getan werden wolle, könne nur „jetzt“ getan werden.
Kümmel unterscheidet Zeiterleben von Zeitvorstellungen. In der Vorstellung wird die Kontinuität der Einheit von Zeit mittels kategorischer Unterscheidungen in diskontinuierlichen Aspekten analysiert. Die Frage nach der Einheit solcher einander ausschließenden Unterscheidungen kann in der Vorstellung prinzipiell nicht widerspruchsfrei beantwortet werden. Jeder Versuch einer einheitlichen Zeitvorstellung muss äußerlich bleiben und führt zwangsläufig in Paradoxien.
Deshalb lässt sich Wandel nicht mit der Vorstellung eines gegenwärtigen Augenblicks (Präsenz) vereinbaren. Mit dem Verweis auf (vergangene) Ursachen und (künftige) Wirkungen wird seine Kontinuität in Diskontinuitäten analysiert. Dauer und Verfließen des Augenblicks verweisen zwar formal auf ihren wechselseitigen Zusammenhang, fallen aber dennoch in der statischen Vorstellung eines ruhenden Zeitraums bzw. eines rastlos vorrückenden Gegenwartspunkts auseinander. Beide verweisen in paradoxer Weise zugleich auf Ruhe und Bewegung.
Das Paradox wird – in unserer kulturellen Tradition – aufgelöst, indem die Ruhe der Dauer/Ewigkeit und die Bewegung/Kontingenz dem Verfließen zugeordnet werden. Im Sinne eines Vorrangs des (überzeitlich gedachten) Seins werde den Dingen dann darüber hinaus eine beharrliche Substanz zugeschrieben und ihr wechselvolles Entstehen und Vergehen auf akzidentielle Bestimmungen eingeschränkt. In einem nächsten Schritt werde das Bleiben überhaupt der Ewigkeit vorbehalten und hinsichtlich der Zeit ausschließlich die Vergänglichkeit betont.
Zum Fallstrick werde, so Kümmel, eine solche aus gänzlich heterogenen Elementen zusammengestückte Zeitvorstellung, wenn der in der Zeit lebende Mensch sich an der einen oder anderen Bestimmung orientieren müsse und hinsichtlich des eigenen Daseins das Werden oder das Vergehen bzw. das Bewirken oder das Erleiden zur je ausschließlich erlebten existentiellen Erfahrung mache. Damit wird eine wechselseitige existenzielle Bezogenheit von Daseinserfahrung und Zeiterfahrung etabliert, die nichts mehr mit objektiver Zeitbestimmung zu tun hat. Obwohl Dauer und Fluss formal ein und dasselbe bezeichnen, verkehrt sich vom einen zum andern der gelebte Sinn. Die existenzielle Differenzerfahrung von Wirken und Leiden hängt an der subjektiven Zeiterfahrung als in die Zukunft voranschreitende oder in die Vergangenheit verfließende, als reversible oder irreversible etc.
Die Selbstverständlichkeit des Zeithabens als Ausdruck unbegrenzter Möglichkeiten und der unabweisbare Zeitmangel als Ausdruck von Vergänglichkeit und verpassten Möglichkeiten führen zu einer in der Sache begründeten Paradoxie. Zwischen Vergangenheit und Zukunft eingeklemmt, werde die Gegenwart zu einem „Nichts“ an Zeit. Zugleich verbürge aber einzig Gegenwart das „Sein“, denn im Unterschied zum Nicht-mehr-Sein des Vergangenen und dem Noch-nicht-Sein des Zukünftigen sei das „Jetzt“ die einzige Zeit, die wirklich „ist“ und auch bezüglich der Zeit-Möglichkeiten letztlich alles zu tragen habe.
Kümmel spricht von der doppelten Aufforderung, die Zeit einerseits aktiv zu gestalten und sich andererseits ihrem verborgenen Eigenwesen zu öffnen und Schritt mit ihr zu halten. Dauer und Fluss sowie Entstehen und Vergehen sind für ihn zwei Seiten einer Medaille. Nur beides zusammen zu berücksichtigen, könne heißen, Gegenwart zu gewinnen und die eigene Absicht mit einem lebendigen Gefühl für das, was hier und jetzt zu tun ist, zu verbinden.
Kümmel: „Identität verflüssigt sich gleichsam in der Fähigkeit zum Gegenwärtigseinkönnen. Wenn es immer von neuem Gegenwart herzustellen gilt, ist eine an den Bildern der Vergangenheit festgemachte Identität von vornherein verloren und bleibt das in die Zukunft projizierte Selbstkonzept ein leeres Versprechen. Selbstidentität zu gewinnen verlangt, sich von vergangener Identität zu lösen und auch vom eigenen Wunschbild noch Abstand zu nehmen, um für immer neue Gegenwart offen zu sein.“
Für Kümmel bedeutet das Sichablösen aus der Herkunft kein Geschichtsverlust, sondern gerade umgekehrt die Bedingung des Geschichtlichwerdens der Zeit und ihrer Gegenwart. Darüber hinaus betont er, dass alle Gegenwart Gegenwart in einer Welt sei, vor und mit anderen Menschen. „Meine Zeit“ ist immer auch „unsere Zeit“, und die eigene Sorge betrifft, ob einer will oder nicht, auch den allgemeinen Weltzustand.
Quelle:
Friedrich Kümmel, Zum Verhältnis von „Zeit“ und „Gegenwart“ in: Der blaue Reiter. Journal für Philosophie Nr. 5, 1/1997, S. 51-55
Kümmel, Friedrich (1933-2021):
Philosoph und Pädagoge, zuletzt an der an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg
Stichworte:
Zeitparadoxien, Zeittheorie
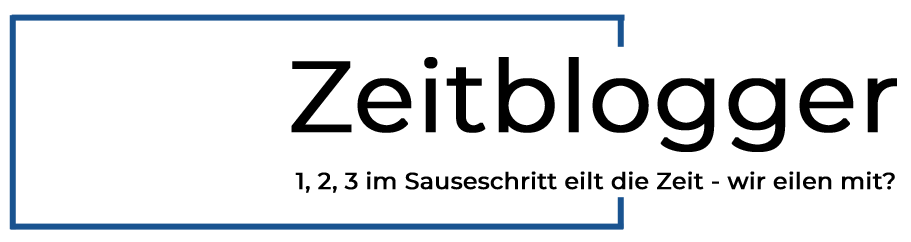
Schreibe einen Kommentar