Anfänge
„Das System denkt an seinen Anfang immer aus der Mitte heraus.“ – (Niklas Luhmann) –
Zeitbestimmung muss irgendwann beginnen, sie benötigt einen Anfang, an dem sie ansetzt. Ein interessierter und zumindest insofern Anteil nehmender Beobachter markiert eine besondere Gegebenheit, ein irgendwie ausgezeichnetes Ereignis als Anfang, an dem er ansetzt, um Zeit zu bestimmen. Dabei bleibt jeder Anfang eine Fortführung von Vorangegangenem, knüpft an Voraussetzungen und Umstände an. Er variiert bereits Bekanntes, das erst als solches als Anfang erkannt, benannt und markiert werden kann.
Zeitbestimmung basiert demnach auf einer rekursiven Figur: Für jeden Anfang gibt es ein Davor, das selbst zeitlich nur durch Markierung eines Anfangs bestimmt werden kann. Das heißt, Anfänge sind repetitiv, Wiederholungen im Zuge einer fortwährend neu ansetzenden, nicht abbrechenden Serie von Zeitbestimmungen, die zumindest solange währt, wie ein involvierter Beobachter versucht, Zeit zu bestimmen.
Die Setzung eines ersten Anfangs oder Ursprungs ist ein kanonisches Verfahren zur Entparadoxierung im Rahmen klassisch metaphysischer Weltvorstellungen, die einen infiniten Regress nicht dulden: Die Zeit ist mit dem Ursprung gegeben und der Ur-Sprung – sei es ein Schöpfergott, ein sich entfaltendes Brahman, ein erster Beweger, eine Idee, eine apriorische Form der Erkenntnis, ein Urknall im Blockuniversum – währt ewig jenseits aller Zeit. In diesen Vorstellungen wird Zeit als objektive Gegebenheit unabhängig vom menschlichen Beobachter als dessen unabdingbare naturgegebene oder transzendentale Voraussetzung gedacht. Zeit wird zu einem fundamentalen Parameter des Weltgeschehens hypostasiert und so der Regressgefahr entzogen.
Bei den klassisch metaphysischen Vorstellungen bleibt es schwierig, wie ein erster Anfang gedacht werden kann, ohne zugleich einen zweiten im Hinterkopf zu haben. Ohne einen zweiten Anfang im Hinterkopf scheint es wenig sinnvoll, über einen ersten überhaupt zu sprechen. Deshalb wird die Ursache aller Zeit transzendiert, also in ein Jenseits transponiert: Sie hat keinen Anfang.
Man kann der Auffassung sein, dass diese klassisch metaphysische Vorgehensweise nur eine verschleiernde Problemverschiebung bringt, weil die Frage nach Ursprung oder Herkunft gewissermaßen outgesourct bzw. ausgeklammert wird. Man darf dabei aber ihre historisch bis in das moderne Fortschrittsdenken entfaltete funktionale Wirkmächtigkeit nicht übersehen.
Dagegen steht ein Denken, das den Blick auf Ursprünge zugunsten einer Möglichkeit fortwährender Neuanfänge nicht so wichtig nimmt (z.B. Hannah Arendt) bzw. den retrospektiven Charakter der Markierung von Anfängen herausstellt (z.B. William Sewell).
Zeit bestimmen bedeutet, einen Anfang und ein Ende (nicht zu setzen, sondern) zu markieren und so für die Dauer eines Verlaufs eine Entität zu fixieren, die über die Präsenz hinaus Abwesendes mit umfasst. Zeit bestimmen geht mit dem synchronen Aspekt einer vorübergehend stabilen (statischen, d.h. wesensmäßig verstandenen) Ganzheit und dem diachronen Aspekt oberflächlicher Gestaltwandlung bei gleichzeitiger Erhaltung der Tiefenstruktur (Wesenhaftigkeit) einher. Geburt und Tod als Zeitbestimmungsmarken konstituieren die Einheit (Entität) eines individuellen Lebens – wie alle Zeitbestimmungsmarken sind sie willkürlich, was deutlich aus der Perspektive von Populationen, Gesellschaften, Kommunikationsgemeinschaften im Sinne Luhmanns oder Generationen wird: Anfänge und Enden (Neuanfänge) sind von einer Metaebene aus betrachtet immer Anschlüsse, nie in einem wörtlichen, sondern nur in einem symbolischen Sinne aus einer speziellen Perspektive Ursprünge.
Quellen:
Niklas Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, (2002)
Elias Norbert, Über die Zeit, Vorwort (1984, zitiert nach 12. TB Auflg. 2017)
William Sewell (2005) Logics of History – Social Theory and social Transformation
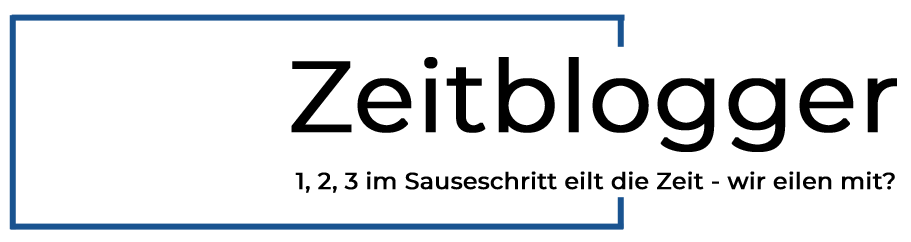
Schreibe einen Kommentar