William Sewell
Sewell hebt darauf ab, dass wissenschaftliche Theorien und dadurch begründete Weltbilder entscheidend von den Zeitkonzeptionen (temporalities) geprägt sind, die ihnen zugrunde liegen. Für die Geschichtswissenschaften unterscheidet er insbesondere drei Zeitkonzeptionen.
Die teleologische Perspektive geht von vorgängigen (transhistorischen) Gesetzen aus, die die Logik natürlicher oder gesellschaftlicher Entwicklungen inhärent vorherbestimmen. Ziel und Sinn von Geschichte sind eine Konsequenz anonymer, langfristig wirksamer Kausalkräfte. Das betrachtete System hat zu jedem beliebigen Zeitpunkt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einen vorgegebenen gesetzmäßigen Zustand (assumption about the uniformity of causalities). Aus Sicht von Sewell postuliert eine solche Konzeption im Schluss von der gegenwärtigen Situation auf die Vergangenheit rückblickend einen unitären Ursprung (Big Bang), der die Zukunft als Potenz (in potentia) bereits präformiert enthält. Wendepunkte (turning points or crucial events), die dem Gang der Geschichte eine neue, unvorhersehbare Richtung geben können, kommen darin nicht vor, sondern werden als Konsequenzen der vorgängigen Gesetze auf den Status von Marksteinen auf dem Weg in eine unhintergehbare Zukunft reduziert.
Ebenfalls unter die teleologische Perspektive fallen Betrachtungen über die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, bei denen beobachtete Unterschiede zwischen als vergleichbar eingestuften Geschehnissen als zur gleichen Zeit auftretende unterschiedliche Phasen bzw. Zustände eines von einem gemeinsamen Ursprung gesetzmäßig fortschreitenden Entwicklungsprozesses interpretiert werden. Sewell sieht in diesem Vorgehen einen Trugschluss, weil ein tatsächlich bestehender, historisch begründeter sozio-geographischer Unterschied in der Gesellschaftsordnung zu Stadien in der linearen Entwicklung eines übergeordneten evolutionären Gesetzes (a kind of eternal yeast) umgedeutet wird.
Die empirische (quasi-experimental, inductive) Perspektive geht davon aus, dass ähnlich gelagerte Ereignisse einer vergleichenden Analyse unterzogen werden können, um Kausalfaktoren aufzudecken, die das Auftreten von bestimmten Ereigniskategorien erklären. Dabei sind unter Kausalfaktoren notwendige, sich wechselseitig stützende bzw. auf einander folgende Bedingungen für das Eintreten von vergleichbaren Ereignisfolgen zu verstehen. Voraussetzung für die Vergleichbarkeit solcher Ereignisse ist Gleichartigkeit und Unabhängigkeit der betrachteten Fälle, die als extrahierte Blöcke gewissermaßen eingefroren und als quasi zeitlose Objekte einer typologischen Klasse behandelt werden, die den gleichen Kausalgesetzen unterliegen und unabhängig von vorangehenden Ereignissen sind. Nach Sewell liefert diese Perspektive keine Beweise für allgemeingültige Gesetze, aber Analogien, um sich aus den Gesamtumständen ergebende, sich entfaltende Wechselwirkungen aus ursprünglich getrennt determinierten Prozessen heraus konkret zu beschreiben. Die empirische Zeitkonzeption legt also eine Ontologie vergleichbarer extrahierbarer Ereignisblöcke zugrunde, die als quasi zeitlose, typisierbare Einheiten Geschichte konstituieren.
Die ereignisorientierte (eventful) Perspektive betont die Wirkkraft singulärer geschichtlicher Ereignisse. Sie geht davon aus, dass die Handlungen und Begegnungen gesellschaftlicher Akteure durch die konstitutiven Strukturen der jeweiligen Gesellschaft zugleich ermöglicht und eingeschränkt werden. Die meisten sozialen Aktionen reproduzieren einfach die bestehenden sozialen und kulturellen Strukturen ohne wesentliche Änderungen. Es gibt aber darüber hinaus hin und wieder auch Ereignisse (events) im engeren Sinn von Umbrüchen, die die gesellschaftlichen und kulturellen Strukturen entscheidend transformieren. Solche Ereignisse können nicht nur die Balance der aktiven Kräfteverhältnisse verschieben, sondern auch die ganze Logik auf den Kopf stellen, die unter gegebenen Umständen und Rahmenbedingungen die anschließende Entwicklung der Gesellschaft kausal bestimmt. Ereignisorientierte Zeitlichkeit geht davon aus, dass die Entwicklung gesellschaftlicher Beziehungen durch den konkreten Verlauf (Wegabhängigkeit), die konkreten Machtverhältnisse (zeitlich heterogene Kausalitäten) und die konkreten Umstände (globale Kontingenz) bestimmt ist. Das soziale Geschehen ist seinem Wesen nach kontingent, diskontinuierlich und ergebnisoffen. Bedeutende und gewichtige soziale Prozesse sind nie vollständig immun gegenüber kleinen, unberechenbar veränderlichen lokalen Einflüssen.
Zusammenfassend: Eine experimentell bestimmte Zeitlichkeit postuliert die zeitunabhängige Konstanz kausaler Gesetze und die kausale Unabhängigkeit von Ereignisfolgen von vorangehenden oder nachfolgenden Ereignissen. Eine teleologisch ausgerichtete Zeitlichkeit besteht auf einer gesetzmäßigen Zielgerichtetheit, akzeptiert aber eine gewisse Pfadabhängigkeit und oberflächliche Kontingenz von Ereignisfolgen. Die ereignisbezogene (eventful) Zeitlichkeit rechnet damit, dass Ereignisfolgen grundsätzlich pfadabhängig sind, also von kontingenten Rahmenbedingungen abhängen, und in ihrem Verlauf einer Verschiebung ursächlicher Zusammenhänge unterliegen können.
Sewell unterscheidet eine synchrone und eine diachrone Perspektive bei historischen Darstellungen: „history as temporal context“, als statisch bzw. faktisch verortet in einer vergangenen Zeit, und „history as transformation“, als Entwicklung oder Verlauf, und plädiert für eine dialektische Oszillation zwischen beiden, um Transformationen – „trans“ und „form“ – wörtlich genommen gerecht zu werden. Im Grunde fordert er für die historische Betrachtung (im Sinne einer interpretierenden bzw. erklärenden Beschreibung) eine sachgerechte Zeitbestimmung, die eine Festlegung von definiertem Ausgangs- und Endzustand als quasi zeitlose, weil „synchrone“ oder simultane Ereignisrelationen voraussetzt, um die Transformation „diachron“ über ein Verlaufgesetz mit Hilfe einer Uhr darzulegen.
Sewell verweist auf die charakteristische Eigenzeitlichkeit von gesellschaftsverändernden Ereignissen (happenings), die niemals auf den Augenblick beschränkt sind, sondern sich immer über einen Zeitraum von dem initialen Bruch mit dem Üblichen bis zur Artikulation eines neuen Selbstverständnisses erstrecken. Das sind Zeiten großer Verunsicherung, in denen die üblichen Routinen grundlegend infrage gestellt sind (Orientierungsverlust) und handelnde Personen existentielle Situationen bewältigen müssen, die sie emotional intensiv fordern (Verlust des Gefühls für einen gesicherten zeitlichen Verlauf: time is out of joint). Er verweist in diesem Zusammenhang auf das englische Verb „to temporize – auf Zeit spielen“: die Eigenzeit einer Situation manipulieren, um Geschehnisse zu beeinflussen bzw. Optionen zu ermöglichen.
Erst die Etablierung eines neuen Selbstverständnisses bringt die Auszeichnung der Geschehnisse als historisches Ereignis zur Geltung. Diese begriffliche Umdeutung (hb: die symbolische Markierung eines Umbruchs, das Setzen einer Zeitmarke für ein Davor und ein Danach, der Beginn einer neuen Zeitrechnung mit Bezug auf endgültig Vergangenes, nicht mehr Präsentes, nur noch Präsentierbares, eine unwiederbringlich absente Realität) gehört für Sewell unabdingbar zu jedem gesellschaftstransformierenden Ereignis.
Voraussetzung gesellschaftsverändernder Ereignisse ist eine punktuelle Verschränkung besonderer Umstände (structure of the conjuncture: the small but locally determining conditions whose interaction in a particular time and place may seal the fates of whole societies). Sewell unterscheidet insbesondere drei Typen von verschränkten Umständen. 1. semantische Rahmenbedingungen: Die Mehrdeutigkeit von Begriffen erlaubt die Vermengung von Bezügen und damit neue Kombinationen und Kontextualisierungen – ein unterbestimmter Begriff, den verschiedene Seiten zunächst in unterschiedlicher Weise verwenden, wird zum Bindeglied, das über Reformulierungen neu zugespitzt einen Neuanfang markieren kann; 2. eine vorgängige Bedeutungszuschreibung für Orte oder Personen als Symbolträger z.B. für Ungerechtigkeit; 3. eine außergewöhnliche emotionale Intensität der Situation, in der Begeisterung und Zorn so zusammen gehen, dass unvorhersehbar Generosität oder Barbarei daraus hervorgehen können.
Auch in politisch und ökonomisch stürmischen Zeiten können durch vorteilhafte Umstände stabile, privilegierte Nischen entstehen, in denen sich bestimmte soziale Gruppen für eine gewisse Zeit beständig einrichten können. Dabei spielen spezifische komplexe wechselseitige Beziehungen zwischen verschiedenen nicht synchronisierten, aber überlappenden Prozessen mit spezifischen Eigenzeiten eine Rolle, die füreinander stabilisierende Rahmenbedingungen schaffen [hb: feedback-Kopplungen]. Für die verschiedenen beteiligten sozialen Prozesse schlägt Sewell eine zeitliche Typologie vor: 1. Trends als gerichtete Veränderungen (Aufstieg, Wachstum, Stagnation, Verfall) in unterschiedlichen, voneinander unabhängigen oder abhängigen Dimensionen (z. B. ökonomisch, sozial); 2. Routinen als unabänderlich geltende Gewohnheiten (auch sprachlicher Natur); 3. Events als Struktur verändernde Ereignisse.
In herkömmlichen soziologischen Diskursen erzeugt der Begriff Struktur nach Sewell, was er bezeichnet. D.h. etwas als Struktur herauszustellen, bedeutet zugleich auch immer Gegebenes zu strukturieren, d.h. einen Aspekt als Begründung für ein Ganzes heranzuziehen und dieses damit festzulegen. Die Begriffsverwendung impliziert fundamentale Stabilität und degradiert Veränderung als sekundäres Phänomen. Sewell entwickelt einen eigenen Strukturbegriff, der den transformierenden Aspekt des Strukturierens stärker zur Geltung bringen soll. Strukturen entstehen demnach aus einer Reihe sich gegenseitig unterstützender Schemata und Ressourcen, die soziales Handeln befähigen und einschränken. Sie werden in der Regel durch das soziale Handeln reproduziert, aber ihre Reproduktion erfolgt nie automatisch. Sie sind immer zumindest bis zu einem gewissen Grad gefährdet, weil sie vielfältig sind und sich überschneiden, weil Schemata transponierbar sind und weil Ressourcen mehrdeutig (polysemisch) und akkumulativ sind. Den grundlegenden Mechanismus struktureller Veränderung beschreibt er als die notwendige, aber riskante Anwendung kultureller Kategorien unter neuartigen Umständen. Die Zuweisung kultureller Bedeutung zu Dingen in der Welt transformiert zumindest gelegentlich die Bedeutung kultureller Kategorien und eröffnet dadurch neue Möglichkeiten für gesellschaftliches Handeln.
Sewell nimmt metaphorischen Bezug auf de Saussures Unterscheidung von Langue und Parole: das synchron (d.h. zeitlos) erfasste Regelwerk der Sprache und dessen praktische, diachrone (d.h. zeitlich entfaltete) Verwendung in der Rede. Langue ermöglicht und beschränkt zugleich Parole, d.h. sie stellt die Mittel zur Verfügung, damit etwas gesagt werden kann, schränkt dadurch aber auch zugleich ein, was gesagt werden kann. Parole reproduziert Langue durch Verwendung, verändert und erweitert sie aber auch zugleich durch spezifische (großzügige) Auslegung der Regeln, was es überhaupt erst erlaubt, sinnvoll über eine unvorhersehbare Welt zu sprechen.
Das Sprachkonzept nach Saussure unterscheidet sich vom Sewellschen Konzept des Sozialen in der Zeitlichkeit (temporality). Ersteres privilegiert die synchrone Perspektive, indem es die Langue (Sprache) über die Parole (Rede) stellt. Veränderung wird im Wesentlichen nur formal, quasi zeitlos, durch reversible logische Verknüpfung der bestehenden Elemente des semiotischen Systems erfasst. Letztere betont dagegen die diachrone Perspektive sowohl von Entstehungsprozessen als auch von Fortbestand in und durch die Zeit.
Menschen sind nach Sewells Auffassung Umwelt transformierende Tiere. Sie agieren in einer physischen Welt, die sie fortwährend ihren Zwecken gemäß verändern. Die gestaltete Umwelt (build environment), in die wir geboren werden, beschränkt und eröffnet Möglichkeiten und vermittelt unsere soziale Lebensform. Durch unser Handeln reproduzieren wir Lebensroutinen und Lebensbedingungen und verändern sie zugleich. Fortbestand durch Reproduktion und Fortschritt durch Variation bestimmen den (iterativen) Gang der Geschichte. Soziale Strukturen (social constructs) werden über die Zeit von verorteten sozialen Akteuren gestaltet, vererbt und umgestaltet. Sie akkumulieren über die Zeit und sind in der physischen Welt instanziiert.
Quellen:
William Sewell, Logics of History – Social Theory and social Transformation (2005)
Weiterlesen:
Link: Titel (Kategorie)
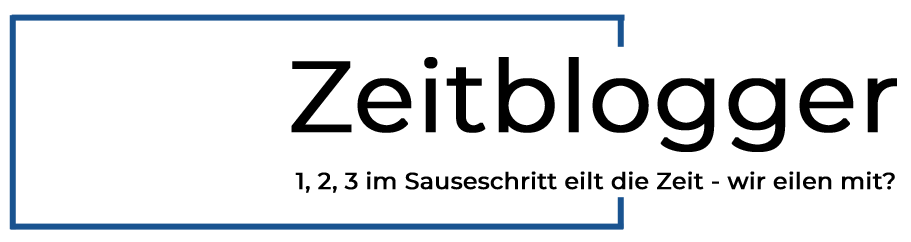
Schreibe einen Kommentar