Peter Bieri
Peter Bieri stellt Zeitvorstellungen unter dem Pseudonym Pascal Mercier in dem Roman „Perlmanns Schweigen“ von 1995 dar. Darin kommt zum Ausdruck, dass sich eine differenzierte Erfahrung von Zeit im Medium Sprache vollzieht, in dem Zeiterleben nicht abgebildet, sondern – insbesondere in Bezug auf eigene Vergangenheit – als Erzählung bzw. Erdichtung sowohl von einem selbst als auch von den anderen geschaffen wird.
Zugleich ist Zeiterleben kontextabhängig, insbesondere in Bezug auf die Offenheit oder Determiniertheit von Zukunft und Vergangenheit. Wenn Handlungsoptionen zur Verfügung stehen, besteht Gestaltungsspielraum und Hoffnung. Unter dem Zwang unabänderbar erscheinender Entwicklungen sowie auch im Angesicht des nahenden Todes reduziert sich Zeiterleben auf eine Abfolge von trägen, gedehnten Momenten, von purem Vergehen in alle Ewigkeit und ohne jede Hoffnung. Wenn andererseits der Kontextbezug z.B. in Isolationshaft abgeschnitten wird, verliert sich mangels Bestätigung schnell die Selbstverständlichkeit und das Vertrauen in die selbst erdichtete Vergangenheit.
In Momenten intensiven Gegenwarterlebens kann der Eindruck entstehen, dass die Zeit nichts ist, was unabhängig fortschreitend von der Außenwelt aufgeprägt wird, sondern etwas, das sich, je nach dem, in welchem Umfang man es zulässt, von Innen heraus als ein gesetzter Aspekt der eigenen Person in reicher oder karger Form in die Welt hinein entfaltet. Das intensive Gegenwartserleben ist aber keine unmittelbare Selbstverständlichkeit. In Zeiten der Zukunftsentwürfe und Zukunftsvorbereitungen kann Gegenwart als etwas erlebt werden, das erst noch kommen wird. Die augenblickliche Gegenwart erscheint dann im Rückblick als etwas Verpasstes, an dem man nur beiläufig teilgehabt hat, das über einen hinweggegangen ist.
Die kontextabhängige Variabilität und die schöpferische Willkür des Zeiterlebens verweisen bereits auf eine Heterogenität der Zeiterfahrung. Bieri geht in seiner Zeitdarstellung noch weiter und beschreibt eine Vielfalt unterschiedlicher Zeiten, die Subjekt gebunden nebeneinander her laufen, sich im eigenen Erleben gelegentlich durchkreuzen oder streckenweise in der Resonanz gemeinsamen Erlebens zusammenlaufen und sich wieder entkoppeln können. Bieri spricht in diesem Zusammenhang über Vervielfältigungen von Wirklichkeit und Zeit, konkurrierende Ebenen der Welterfahrung, die jeweils für sich beanspruchen, die wirkliche Zeit zu sein. Eingehüllt in eine je eigene, nicht geteilte Zeit können vertraute Personen fremd erscheinen. Einander ausschließendes Zeiterleben führt zu (Selbst-)Ausgrenzung, Entfremdung, Abschottung, Entzug und kann begleitet sein von Zweifeln, Verdächtigungen, Verlusterfahrungen.
An der Bruchkante mehr oder weniger unerwartet eintretender, überraschender und unumkehrbarer Ereignisse kann das Zeiterleben von Gefühlen der Selbstbestimmtheit und Hoffnung umschlagen in Gefühle der Fremdbestimmtheit und der Ausweglosigkeit. Daraus gehen Situationen existenzieller Selbsterfahrung begleitet von
Was-wäre-wenn-ich gewußt-hätte-Gedanken im Sinne Kierkegaards hervor. Die Gewissheit, es nicht besser gewusst zu haben, gepaart mit der Möglichkeit, auch anders gehandelt haben zu können, beschwört die Verzweiflung an einer Verantwortung für Entscheidungen herauf, deren Folgen nicht absehbar waren.
An der Bruchkante nicht revidierbarer Ereignisse kann sich aber, wie Bieri ebenfalls vorführt, auch eine gegenteilige Erfahrung manifestieren. Eine Entscheidung, deren Konsequenzen nicht absehbar waren, kann günstige Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen, die als unfassbar glückliche Umstände Zeiterleben von auswegloser Determiniertheit in hoffnungsvolle Offenheit umschlagen lässt.
Quellen:
Pascal Mercier, Perlmanns Schweigen (1995
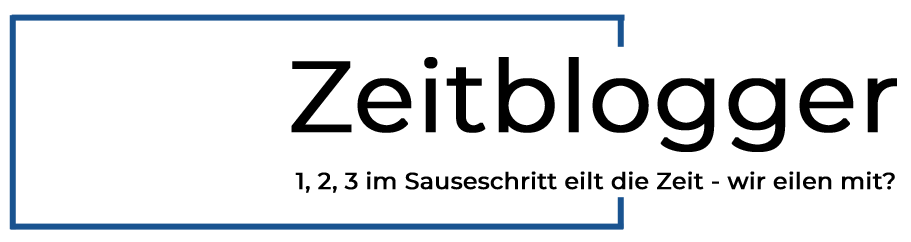
Schreibe einen Kommentar