Marcel Merleau-Ponty
Zeit stellt einen grundlegenden Begriff für die ontologische Fundierung der Phänomenologie bei Marcel Merleau-Ponty dar. Obwohl er keine explizite Zeittheorie vorlegt, sucht er in seinen Hauptwerken dezidiert nach einer Auffassung, die Zeit als Phänomen unabhängig und eigenständig zwischen bzw. außerhalb von Subjekt und Welt verortet. Damit wendet er sich sowohl gegen den Naturalismus eines Isaac Newton, der Zeit als nicht weiter reduzierbaren Basisparameter der Welt zuordnet, als auch gegen den Transzendentalidealismus eines Immanuel Kant, der die Zeit als apriorische Erkenntnisform im inneren Sinn verortet und damit dem Subjekt zuschreibt. Im Einklang mit der abendländischen Tradition von Homer bis Husserl und Heidegger geht Merleau-Ponty dennoch davon aus, dass Zeit eine einheitliche phänomenale Gegebenheit ist, die als solche zwar nicht objektivierbar ist, aber ontologisch befragt, d.h. aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden kann.
Maurice Merleau-Ponty stellt den medialen Charakter von Zeit heraus, in dem sich die strukturellen Voraussetzungen ausbilden, die Objekte, Verläufe und Ereignisse durch Entfaltung aus der Präsenz (Gegenwart) in Vergangenheit und Zukunft ermöglichen. Leiblichkeit als transzendentales Bindeglied zwischen Subjekt und Welt ermöglicht in Verbindung mit der ursprünglichen Zeit das phänomenale Erscheinen der Welt in den modalen Dimensionen der entfalteten Zeit. Aus der Perspektive des Subjekts erscheint Zeit dann als Zusammenhang und Horizont der Erfahrung. Entscheidend ist dabei die wechselseitige Beziehung von Zeit und Subjekt (Leib): Zeit ermöglicht Erfahrungszusammenhang und Weltbezug des Subjekts; das Subjekt bietet die Gelegenheit der Entfaltung von Zeit in die modalen Dimensionen der phänomenalen Welt.
Ursprüngliche Zeit ist Zeit in statu nascendi, nie abgeschlossen und stets offen für Neues. Sie wird in ihrer beständigen Entfaltung erfahrbar, ohne sich je in ihrer Entfaltung zu erschöpfen. Sie kann nur aus der Perspektive entfalteter Phänomene anvisiert, aber nie als das, was sie ursprünglich ist, vollständig in den Blick genommen werden. Sie entzieht sich der Objektivierung und kann vom Subjekt nur perspektivisch beleuchtet (befragt) werden.
Zeit und Subjektivität sind gleichermaßen von der Unterscheidung gegenwärtig/nicht-gegenwärtig (hb: präsent/abwesend) geprägt. Aus subjektiver Perspektive ist Gegenwart von etwas nur vor dem Hintergrund oder dem Horizont von abwesenden Dingen möglich und aus zeitlicher Perspektive ist die Gegenwart eines Augenblicks nur vor dem Hintergrund gleichzeitiger Nicht-Gegenwart möglich. Letzteres heißt zugleich, dass die Zeit nicht als eine Summe aneinander gereihter Gegenwarten, sondern durch die Trennung des Gegenwärtigen von dem, was nicht gegenwärtig ist, konstituiert wird. Diese Struktur macht sie aufnahmefähig für anderes, fähig zum Bezug auf ein Außen. Sowohl Subjekt als auch Zeit sind offen für Neues.
Quellen:
Förster Yvonne, Die Zeit als Subjekt und das Subjekt als Zeit. Zum Zeitbegriff Merleau-Pontys (2009)
Weiterlesen:
Link: Titel (Kategorie)
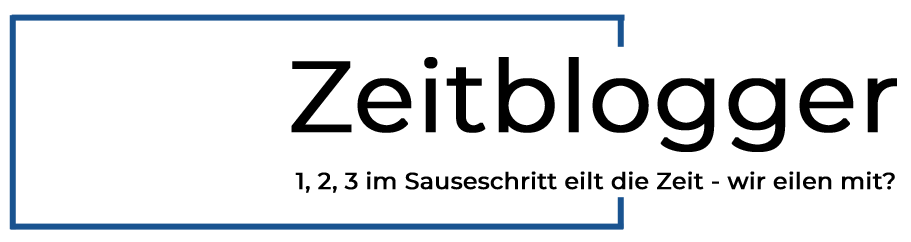
Schreibe einen Kommentar