Michel Foucault
Michel Foucault bricht mit überkommenen Vorstellungen, nach denen die Geschichte einem unwandelbaren, endlosen, transzendentalen Gesetz – einem apriorischen Wesen von Vernunft, Mensch oder Natur – folgend linear, kontinuierlich und kumulativ verläuft. Stattdessen emergiert die historische Situiertheit des Menschen kontingent im Wechselspiel von jeweils spezifischen Machtverhältnissen und epistemischen Selbstverständnissen. Historische Zeit bildet ein Potpourri aus diskreten und diskontinuierlichen mehr oder weniger stabilen, d.h. nur langsam evolvierenden, in spezifischen Diskursen der Macht und des Wissens jeweils neu ausgehandelten Epochen, die durch kontingente, plötzlich und rasch umsichgreifende, radikale Verschiebungen der Machtverhältnisse und des epistemischen Selbstverständnisses in anders gestrickte Epochen umkippen.
Zeitvorstellungen spielen dabei eine große Rolle für das kontingente, spezifische epistemische Selbstverständnis einer Epoche. Foucault erläutert dies beispielhaft an einem Umbruch an der Wende zum 19. Jhdt., als die vormaligen idealisierenden Genealogien ihre Glaubwürdigkeit einbüßten. Diese jetzt als konstruiert erkannten Genealogien setzten den Menschen einer spezifischen Zeitgebundenheit aus und platzierten ihn unverrückbar im Zentrum des Weltgeschehens, indem sie ihn über seine Herkunft unentrinnbar an unumstößlich vorgegebene Lebensinhalte und Lebensformen banden. Von da an verzweigte das historische Geschehen in ein Kaleidoskop verschiedener Entwürfe und Diskurse (Marxismus, Positivismus, Phänomenologie), die das Recht beanspruchten, das epistemische Selbstverständnis aus Herkunft/Ursprung und Ziel/Zweck des Menschen neu zu bestimmen und durchzusetzen.
Dabei wird Geschichte nicht von einem Kontinuität implizierenden Kampf regiert, sondern unterliegt der Nietzscheanisch verstandenen, „konkreten Gegebenheit einer Entwicklung mit ihren Entgleisungen, ihren ausgedehnten Perioden fieberiger Aktivität, ihren Ohnmachten“. Geschichte erscheint als Ensemble komplexer, ineinandergreifender Konflikte zwischen Wünschen und Kräften (desires and powers), die sich hinter Wahrheitsansprüchen (Willen zur Wahrheit) verbergen. Unter den Auseinandersetzungen um Macht und Wissen, die sich dynamisch in historisch konstruierten Gegenständen (Dispositiven, zeitbeherrschenden Themen) niederschlagen, gestaltet sich Geschichte weder kontinuierlich noch homogen. Dennoch ist sie nicht völlig chaotisch, denn Beziehungen zwischen Macht und Wissen sind keine statischen Verteilungsfunktionen. Foucault spricht von Transformationsmatrizen (matrices of transformations), die unter den Bedingungen lokaler Gegebenheiten organisierte Zeitsequenzen erzeugen. Geschichte steht unter der doppelten Konditionierung (double conditioning) von transformierenden Kräften und konkreten Rahmenbedingungen, die sich wechselseitig beeinflussen. Die allgemeine Form temporaler Prozesse schaut dabei, so Machon, aus wie ein Bouquet auf- oder absteigender Spiralen.
Der Bruch umfasst nicht nur eine Veränderung der vorherrschenden Subjektivierungsform, sondern auch eine Veränderung der Form der Zeitlichkeit selbst, die einen neuen Rhythmus annimmt. Im Zuge historischer Transformationen variiert auch das subjektive Zeitempfinden. Foucault erläutert dies am Beispiel der radikalen Lebensstilveränderungen anlässlich der Christianisierung im Römischen Reich durch Konstantin. Seit dem Sieg des Christentums, als das Leben nicht mehr Gegenstand einer Stilisierung (Selbstgestaltung), sondern Gegenstand einer Hermeneutik (Selbstauslegung) wurde, dominierte ein neuer Typus der Geschichtlichkeit. Weil der Einzelne nicht mehr die Aufgabe hatte, sich selbst zu vervollkommnen, sein Verhalten, seine Gefühle und seine Existenz zu optimieren, sondern sich selbst, seine inneren Geheimnisse und seine verborgene Wahrheit, zu entdecken, und weil er sich seinem Körper gegenüber nicht länger wie gegenüber einem von außen zu gestaltenden Objekt verhalten muss, sondern eher auf ihn hören muss wie in einem Diskurs, kann sich Zeit nicht aus einer Folge von Bemühungen zusammensetzen, die Gegenwart und ihren langsamen Verlauf zu intensivieren. Stattdessen wird die Zeit zu einer Reise, die zurückgelegt werden muss, in einer Gegenwart, die immer von der Zukunft bestimmt wird. Mit der Institutionalisierung des „Subject of desire and want“ betritt die zielorientierte und immer unausgeglichene Geschichtlichkeit, in der wir heute noch leben, die Bühne.
Modern sein bedeutet für Foucault sich selbst als Gegenstand einer Vervollkommnung zu betrachten, als Projekt, seine ganze Existenz zu einem Kunstwerk zu machen – eine Ethik als eine Ästhetik der Existenz. Solche „Praktiken der Freiheit“ sind genötigt, ständig Neues hervorzubringen als zeitlose Vertikale, senkrecht zum Verlauf der Geschichte, um die vergehende Zeit zu durchbrechen.
Zeit erscheint bei Foucault abhängig von den (beschriebenen) Gegenständen (Dispositive), deren Transformationen sie misst, aber diese Gegenstände sind selbst auf moralische und politische Projekte zugeschnitten. Zeit kann modelliert werden als stratifizierter Fluss unterschiedlich schnell ablaufender Zeitlichkeiten, als Folge immobiler Blöcke, die durch rasche Umbrüche voneinander getrennt sind, als Sukzession ausbrechender Ereignisse, als Serie von spiralförmig fortschreitenden Abfolgen, als aufeinander folgende langsam systematisch driftende Zeitabschnitte oder als Gegenwart, die ihre Freiheitspraktiken orthogonal zum Zeitfluss errichtet.
Quellen:
Pascal Michon (2002) Strata Blocks Pieces Spirals Elastics and Verticals – Six figures of time in Michel Foucault, in Time & Society 11 (2/3), S. 163 ff.
Weiterlesen:
Link: Titel (Kategorie)
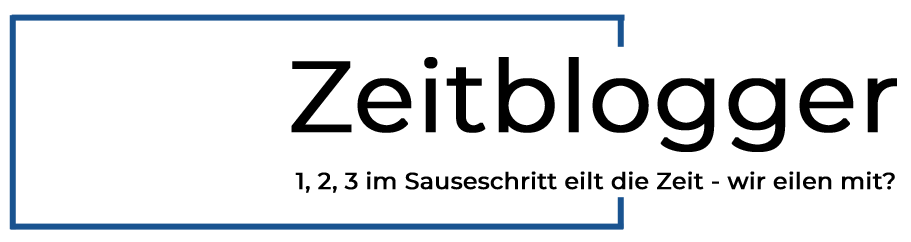
Schreibe einen Kommentar