Norbert Elias
Der Ausgangspunkt von Norbert Elias ist die Frage nach der Funktion von Zeit, die er weder als subjektive noch als objektive Gegebenheit gelten lässt. Aus wissenssoziologischer und wissen(schafts)historischer Sicht charakterisiert er Zeit als Tätigkeit des Zeitbestimmens, die im Wesentlichen darin besteht Ereigniskonstellationen symbolisch zu erfassen. In modernen industriell geprägten Gesellschaften ist Zeit, was die Uhr anzeigt: eine Relation von Zeigerpositionen, die mittels eines regelhaften Mechanismus in standardisierten proportionalen Relationen zyklisch wiederkehren.
Mit anderen Worten, zeitliche Ausdrucksformen bezeichnen Beziehungen zwischen Einzelereignissen aus verschiedenen Geschehensabläufen und repräsentieren diese Relation begrifflich als sprachliches Symbol. Sie setzen Orientierungspunkte im Beziehungsgeflecht natürlicher und sozialer Abläufe, in die Menschen als Gemeinschaft eingebunden sind. Dabei präsentiert der sprachliche Ausdruck eine allgemeine Form ohne konkreten Inhalt. So behauptet der Ausdruck „gestern“ beispielsweise formal einen realen kontinuierlichen Zusammenhang zwischen einem beliebigen gegenwärtigen Geschehen und erinnerten oder aus Dokumenten erschlossenen Geschehensabläufen. In der kommunikativen Anwendung wird er in der Regel inhaltlich mit einer bestimmten Gegenwart und Verweisen auf bestimmte nicht präsente Geschehensabläufe konkretisiert.
Einen Hauptschlüssel zu den Problemen der Zeit und des Zeitbestimmens sieht E. in der Gedächtnisfunktion, die es Menschen erlaubt, zusammen zu sehen, was nicht zusammen geschieht. Er spricht von einer Synthese, durch die in der Vorstellung etwas, was realiter jetzt und hier nicht gegenwärtig ist, gegenwärtig und mit etwas verknüpft wird, was jetzt und hier realiter geschieht. Elias: „Begriffe wie »früher« und »später« sind Manifestationen der menschlichen Fähigkeit, sich zusammen vorzustellen, was nicht zusammen geschieht, und was auch von Menschen als nicht zusammen Geschehendes erlebt wird.“
Ein symbolischer zeitlicher Sprachausdruck wird entweder verwendet, um insbesondere abwesende, gemeinsam auftretende Ereignisse in der Regel in Bezug auf präsente Ereignisse als Ensemble zu bezeichnen oder darum, einen Zusammenhang zwischen nicht gemeinsam auftretenden Geschehnissen zu stiften. Elias gibt drei auf Handeln bezogene, sozial institutionalisierte Funktionen symbolischer zeitlicher Sprachausdrücke an: Orientierung, Kommunikation und Regulation. Im Zuge verschiedener Gesellschaftsentwicklungen haben sich diese Funktionen in jeweils spezifisch benennbarer Hinsicht verändert.
Elias entwirft ein stufenförmiges Konzept von der historischen Entwicklung des Zeitbestimmens, bei dem er den Zusammenhang von Zeit und Macht sowie die Rolle von Monopolen zur Zeitbestimmung, die Motivation durch lebenswirklichkeitsrelevante Bezüge sowie die zunehmende „Objektadäquanz“ und die Balance von Impulsivität und Impuls(selbst)kontrolle herausstellt. Bereits auf einer frühen Stufe gesellschaftlicher Entwicklung gibt es ein „passives“, noch nicht explizites Zeitbestimmen, das in „wenn, dann“-Konstellationen zum Ausdruck kommt: Man isst, wenn man Hunger hat. Auf späterer Stufe werden diese „wenn, dann“-Konstellationen als „wann, dann“-Konstellationen gemäß einer differenzierteren sozialen Organisation reguliert und strukturiert, die die Menschen bis zu einem gewissen Punkt zwingt, ihre physiologische Uhr an einer sozialen Uhr auszurichten und so zu disziplinieren.
Die Verwendung zeitlicher (verlautbarer) Sprachausdrücke wird im Zuge der Sozialisation vermittelt und erlernt. In differenzierten Gesellschaften fungiert diese erworbene Kompetenz als soziale Institution der kommunikativen Koordinierung und Regulierung des sozialen Zusammenlebens. Jeder Heranwachsende muss im Umgang mit dieser Institution eine „Selbstzwangapparatur“ entwickeln, damit er in der Lage ist, sich als Erwachsener in der Gesellschaft zurechtzufinden. Elias spricht von einem „Zeitgewissen“, das als „sozialer Habitus“ integraler Bestandteil jeder individuellen Persönlichkeitsstruktur ist. Zeit bezeichnet bei ihm also sowohl die erworbene Kompetenz des Zeiterlebens (Zeitsensibilität) als auch die untrennbar damit verbundene soziale Institution einer standardisierten Zeitordnung, die so stark inkorporiert ist (Zeitdisziplin), das sie wie eine unentrinnbare Gegebenheit erscheint.
Der Zeitbegriff hat selbst eine Geschichte. Er ist aus Vorstellungen hervorgegangen, die nur aus der Sicht im Nachhinein zeitlich verstanden werden können. Im Selbstverständnis archaischer Menschen entwickelt er sich aus punktuell an Einzelereignisse gekoppelten Auslösern für jeweils bestimmte Verhaltensweisen. Diese rückbezügliche Argumentation, die den Zeitbegriff für die Darstellung seiner eigenen Entstehungsgeschichte in Anspruch nimmt, ist insofern gerechtfertigt, als der Zeit kein substanzieller, sondern nur ein symbolischer Status zuerkannt wird. Zeitvorstellung und Zeitempfinden entstehen nicht in der Zeit, sondern in einem Prozess, der – aus heutiger Sicht – mit dem Mittel zeitlich-symbolischer Sprachausdrücke beschrieben wird.
Für den direkten oder indirekten Vergleich räumlicher Beziehungen hat der Mensch im Laufe seiner Entwicklung den konstanten Maßstab als statisches Symbol im Sinne einer standardisierten Maßeinheit entwickelt. Für den direkten oder indirekten Vergleich von Abläufen hat er einen unabhängigen, sich relativ gleichmäßig wiederholenden Geschehensablauf als dynamisches Symbol im Sinne einer standardisierten Zeiteinheit entwickelt. Elias: „Wieweit menschliche Gruppen Ereignisse »zeiten«, also in der Dimension von »Zeit« erleben können, hängt ganz davon ab, wieweit sie in ihrer sozialen Praxis vor Probleme gestellt werden, die ein Zeitbestimmen erforderlich machen, und wieweit ihre gesellschaftliche Organisation und ihr Wissen sie befähigen, eine Wandlungsreihe als Bezugsrahmen und Maßstab für andere zu benutzen.“
Quellen:
Elias Norbert, Über die Zeit, Vorwort (1984, zitiert nach 12. TB Auflg. 2017)
Weiterlesen:
Link: Titel (Kategorie)
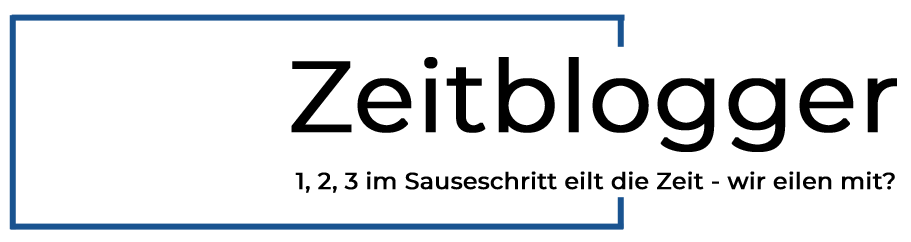
Schreibe einen Kommentar