Dean Buonomano
Buonomano verweist auf die Pluralität der Verwendung des Begriffs Zeit. Für seine Zwecke unterscheidet er drei Bedeutungen: Naturzeit (Zeit als Medium oder Dimension der Natur), Uhrzeit (die Zeit des Physikers) und Subjektzeit (das vom Gehirn produzierte subjektive Gefühl von Zeitfluss und Dauer). Als Neurowissenschaftler interessieren ihn die Fragen, wie und warum das menschliche Gehirn ein intensives Empfinden für das Vergehen der Zeit generiert. Das Gehirn ist in seinen Augen eine Zeitmaschine, die Zeit anzeigt, die Zukunft vorhersagt und darüber hinaus mentale Zeitreisen ermöglicht. Er betont, dass erst die Fähigkeit zu mentalen Reisen in die Zukunft den Menschen in die Lage versetzt hat, Steinwerkzeuge herzustellen oder den Zusammenhang zwischen Aussaat und zukünftigem Überleben zu verstehen.
Nicht nur das Gehirn, sondern Lebewesen ganz allgemein generieren autonome physiologische Prozesse, die intern auf der Ebene von Zellen, Geweben und Organismen Zeit „anzeigen“. Diese so genannten biologischen Uhren unterscheiden sich deutlich von technisch hergestellten Uhren. Während Atomuhren unspezifisch über viele Größenordnungen Zeit anzeigen, sind biologische Uhren größenordnungsspezifisch. Das Gehirn verfügt über eine Vielzahl von mehr oder weniger autonomen, spezifischen Mechanismen, die interne Standards für das Verstreichen der Zeit über eine Spanne von zwölf Größenordnungen vom Millisekundenbereich bis zur Bestimmung der Jahreszeiten generieren. Buonomano spricht von einer „different-clocks-for-different-time-scales strategy“ bzw. einem „multiple clock principle“. Deshalb hat beispielsweise die circadiane Uhr keinen direkten Einfluss auf die Fähigkeit, Zeitintervalle im Sekunden- oder Minutenbereich zu schätzen: Sie hat weder einen Sekunden- noch einen Minutenzeiger. Sie hat nur einen indirekten Einfluss, insofern sie die Performance aller physiologischen und kognitiven Fähigkeiten einschließlich aller anderen biologischen Uhren im Tagesverlauf prägt.
Buonomano unterscheidet prospektive – von der Gegenwart in die Zukunft verlaufende, z. B. mit einer Stoppuhr gemessene – und retrospektive – aus der Gegenwart zurück in die Vergangenheit extrapolierte, z.B. aus bekannten endenden Abläufen resultierende Zeitbestimmungen. Im ersten Fall kann nichts über Zeiten vor dem Start der Stoppuhr gesagt werden, im zweiten Fall nichts über Zeiten nach Ende des Ablaufs. Beide Formen der Zeitbestimmung gehören zum Alltagsleben, aber beide werden auf unterschiedliche Weise vom Gehirn verarbeitet. Prospektive Zeitbestimmung ist eine genuine Hirnfunktion, retrospektive Zeitbestimmung ist überhaupt keine Zeitmessung, sondern eine Schlussfolgerung aus erinnerten Ereignissen.
In der prospektiven Sicht erscheinen ereignisarme Wartezeiten lang und ereignisreiche Erlebniszeiten kurz. In der retrospektiven Sicht erscheint die ereignisarm erinnerte Wartezeit kurz und die ereignisreich erinnerte Erlebniszeit lang. Dieser Zusammenhang von Erinnern und Zeitgefühl ist experimentell untersucht und bestätigt. Er wird für die ausgeprägten kontextabhängigen Fehleinschätzungen von Zeitdauern in Alltagssituationen verantwortlich gemacht, kann aber auch manipulativ instrumentalisiert werden, wenn z.B. empfundene Wartezeiten durch Musikeinspielung kürzer erscheinen. Es kann darüber hinaus zu Differenzen zwischen individuellen Zeiterwartungen und standardisierten („objektiven“) Zeitverläufen kommen (Zeitillusionen).
Buonomano unterscheidet Präzision und Akkuranz von Uhren. Präzision bezeichnet die durchschnittliche Abweichung des Oszillators über viele Zyklen hinweg; Akkuranz die Korrelation der durchschnittlichen Periodendauer in Bezug auf eine externe Referenz. Die circadiane Uhr ist vergleichsweise akkurat mit tendenziellen Abweichungen vom 24-Stunden-Tageszyklus von plus zwei Prozent bei tagaktiven Tieren und von minus zwei Prozent bei nachtaktiven Tieren. Die Präzision biologischer Uhren ist mit Abweichungen von tendenziell ein Prozent der Periodendauer besser als jede vor dem 17. Jh. hergestellte Uhr, bis Christiaan Huygens die ersten hochpräzisen Pendeluhren baute.
Biologische Uhren sind zwar gute Oszillatoren, aber im Unterschied zur Verwendung technisch hergestellter Uhren sind Lebewesen kaum in der Lage, Perioden zu zählen. Während erstere vor allem verwendet werden, um die Dauer von Ereignissen zu bestimmen, die kürzer als die Periodendauer sind (infraperiod timing), werden letztere vor allem verwendet, um Zeitdauern über viele Perioden zu messen (supraperiod timing). Die circadiane Uhr verrät, wann Morgen oder Abend ist, aber nicht, wie viele Tage vergangen sind. Wie eine Sanduhr muss sie nach jedem Ablauf resettet werden. Konsequenzen wie z.B. Jetlag sind dem Faktum geschuldet, dass ein solcher Reset – im Gegensatz zur technisch hergestellten Uhr – nicht von jetzt auf gleich möglich ist, weil er in hohem Maße phasenabhängig ist.
Biologische Uhren vermitteln kein Zeitgefühl, dafür gibt es andere zentralnervöse Mechanismen. Buonomano spricht vom 6. Sinn, dem aber kein Sinnesorgan wie Auge oder Ohr zugrundeliegt, weil Zeit keine physikalische Eigenschaft in der Art von Lichtwellen oder Druckschwankungen ist. Dennoch misst das Gehirn nicht nur Zeit, sondern vermittelt darüber hinaus ein Gefühl für das Vergehen der Zeit. Allerdings kann die empfundene Zeit stark von der objektiven Uhrenzeit abweichen, was insofern nicht verwunderlich ist, als nahezu alle subjektiven Erfahrungen einschließlich der Farb- und Schmerzwahrnehmung sowie des Körpergefühls von Kontexten, Kenntnissen, Aufmerksamkeit und Wirkstoffeinflüssen geprägt werden. Unser Zeitempfinden ist tatsächlich ziemlich ungenau und stark vom Kontext beeinflusst.
Experimente mit chronopharmakologischen Substanzen legen nahe, dass es weder einen dominanten regulatorischen Neurotransmitter noch eine „master internal clock“ gibt, die das Zeitempfinden global fixiert oder reguliert. Aussagen über empfundene Zeitdilatation oder Zeitkontraktion nehmen konventioneller Weise Bezug auf externe Zeitmesser, auch wenn es die (hypothetische) innere Uhr ist, deren Geschwindigkeit – z.B. unter Drogeneinfluss – modifiziert wird. Störungen des Zeitempfindens scheinen insgesamt eher die Regel als die Ausnahme zu sein. Versuchspersonen neigen dazu, Zeitdauern zu überschätzen. Zudem könnte es sein, dass die neuronale Markierung von Ereignissen als schnell oder langsam unabhängig von der Rate ist, mit der das Gehirn tatsächlich Zeitbestimmungen prozessiert.
Für das Generieren und Verstehen von Sprache und Musik bedeutet Zeit dasselbe wie Raum für das Erkennen von visuellen Objekten, nur dass die relevanten sprachlichen und musikalischen Merkmale über die Zeit integriert werden müssen, also nicht wie bei der Erkennung von Gegenständen zugleich präsent sind. Pausen und Sprechgeschwindigkeit strukturieren Wortbezüge und Satzbedeutungen, unterschiedliche Anlautzeiten (voice onset time) diskriminieren ähnlich klingende Silben (Phoneme). Auch Emotionen und Intentionen kommen im zeitlichen Verlauf und der zeitlichen Charakteristik der Rede (Prosodie) zum Ausdruck. Insgesamt müssen die Gehirne von Zuhörern und Sprechern gleichermaßen eine Reihe komplexer, hierarchisch strukturierter (senso-motorischer) Timing-Probleme lösen – eine Aufgabe, die die Fähigkeiten eines einfachen uhrartigen Geräts eher übersteigt.
Sprache und Musik sind abhängig von der Prozessionsgeschwindigkeit und verlieren ihre Verständlichkeit, wenn zu stark verlangsamt oder beschleunigt. Das Timing im Subsekundenbereich ist Voraussetzung, um „sowohl den Wald als auch die Bäume zu sehen“. Das Verlangsamen von Sprache und das Verlängern von Pausen zwischen Wörtern erleichtert erwachsenen und kleinkindlichen Anfängern das Erlernen einer Sprache. Sowohl bei Menschen wie bei Singvögeln gibt es eine kritische Phase für das Erlernen von Vokalisationen im Verlauf der Entwicklung.
Ein großes neuronales Netzwerk kann nicht nur für einen, sondern für viele ereignisspezifische Timer kodieren. Durch motorische Kopplung können damit spezifische Bewegungen zu vorgegebenen Zeiten ausgelöst werden. Am Beispiel der C14-Datierung, einer der zuverlässigsten Methoden der retrospektiven Zeitbestimmung, erläutert Buonomano, wie die statistische Eintrittswahrscheinlichkeit eines Zerfallsereignisses für ein einzelnes Atom es erlaubt – via Halbwertszeit – Abschätzungen über die erforderliche Zeit aus der davon betroffenen Menge von Atomen zu gewinnen: Umso größer die Menge (Population) der beobachteten Atome, desto genauer die Zeitbestimmung, obwohl über den Zerfall eines einzelnen Atoms nichts ausgesagt werden kann.
Er verwendet das Beispiel als Analogie zu populationsbasierten Uhren im Gehirn, die auf die Subpopulation aktiver Neurone zu einem bestimmten Zeitpunkt Bezug nehmen. Komplexe dynamische nichtlineare und rückgekoppelte neuronale Netze sind chaotisch, können aber trotzdem reproduzierbare Aktivitätsmuster generieren. Die Zusammenhänge sind unverstanden. Aber es ist möglich, die Stärke der synaptischen Verbindungen eines künstlichen neuronalen Netzwerks so zu tunen, dass es selbst bei Störungen in der Lage ist, reproduzierbare Outputmuster zu generieren. Die Information, die das Outputmuster generiert, ist überall und nirgendwo. Jedes Schaltelement trägt dazu bei, aber kein einzelnes ist dafür erforderlich. „The pattern is an emergent property: the whole is larger than the sum of the parts.“
Das Gehirn kann die Dynamik neuronaler Netzwerke nutzen, um Korrelationen zwischen internen Netzwerkzuständen und Veränderungen in der Umwelt zu etablieren. Das Klopfen eines Fingers im Sekundentakt bedeutet nichts anderes, als Gehirnprozesse mit einer Uhr abzugleichen. Das ist letzten Endes alles, was gemeint ist, wenn erklärt wird, das Gehirn zeige Zeit an.
Neurophysiologische Experimente weisen darauf hin, das Raum- und Zeiterfahrung wechselseitig abhängig voneinander sind. Es wird angenommen und evolutionär begründet, dass zeitliche Einordnungen auf räumliche Präsentationsformen zurückgreifen. Für diese These spricht, dass Menschen oft räumliche Begriffe verwenden, wenn sie über Zeit sprechen und dabei auf – kulturell geprägte und perspektivierte – Metaphern der Verräumlichung von Zeit oder von Zeit als einem bewegten Objekt zurückgreifen. Linguistisch betrachtet werden häufiger räumliche Metaphern verwendet, um über Zeit zu sprechen, als umgekehrt. Die Verwendung von räumlichen Metaphern ist allerdings auch in vielen anderen, vor allem sozialen Zusammenhängen sehr gebräuchlich.
Am Beispiel von Instrumenten auf einer Konzertbühne erläutert Buonomano die wechselseitige Abhängigkeit von Raum- und Zeitempfinden. Akustische und optische Reize, die die Sinnesorgane mit unterschiedlichem Delay erreichen, können in bestimmten Kontexten in der Vorstellung als gleichzeitig wahrgenommen werden (psychologische Relativität der Gleichzeitigkeit). Trotz eines Auflösungsvermögens von etwa 20 Millisekunden vermittelt das Gehirn akustische und visuelle Reize aus derselben Quelle mit einem Delay von bis zu 100 Millisekunden als integrierte einheitliche Wahrnehmung (temporal window of integration, which is not fixed but adaptable) – aber nur wenn das visuelle Signal vor dem akustischen registriert wird!
Das Bewusstsein liefert kein tatsächliches Abbild der Welt, sondern eine hochgradig verarbeitete Interpretation der Realität. Beispielhaft verweist Buonomano darauf, dass der Mensch in Phasen des Blinzelns und der Augenbewegung blind ist, ohne davon zu wissen. Es gibt Schätzungen, nach denen er im Laufe des Tages den Informationsgehalt einer Stunde versäumt, ohne es zu merken. Darüber hinaus können spätere Ereignisse die zeitlich integrierte bewusste Vorstellung über zeitlich vorangehende Ereignisse beeinflussen oder verzerren. In der Sprache können beispielsweise nachfolgende Prädikate vorangehende Subjekte semantisch konturieren.
Das Bewusstsein reflektiert nicht die tatsächliche zeitliche Struktur von Geschehnissen, sondern es ist eher so, dass das Unterbewusstsein die eingehenden Wahrnehmungsströme kontinuierlich prozessiert, aber dabei auf kritische Momente wartet, bevor es eine bereinigte Vorstellung ins Bewusstsein sendet (backward editing in time). Der time-lag bis zur Bewusstwerdung (concious present) einer in der Regel sehr selektiven und hochgradig verarbeiteten Vorstellung kann länger als eine Drittelsekunde dauern.
Das Gehirn extrahiert aus Wahrgenommenem und Erlebtem ständig alle Muster, die es darin finden kann, um Sinn in das Umweltgeschehen zu bringen. Insbesondere greift es auf Erfahrungen aus der Vergangenheit zurück, um Rückschlüsse auf Zeit und Raum zu ziehen. Die evolutionär hervorgebrachte Funktion des Gedächtnisses besteht nach Buonomano nicht darin, Vergangenheit zu dokumentierten, sondern darin, eine Orientierungsbasis für Zukunftsprognosen und Handlungsentscheidungen zu generieren. Das Gehirn ist eine Vorhersage- bzw. Antizipationsmaschine, die fortwährend die mögliche Zukunft erkundet, nur gelegentlich setzt es auch Zeitmarken, die es erlauben, episodische Erinnerungen auf der Zeitschiene zu verorten.
„The brain cuts, pauses, and pastes the reel of reality before feeding the mind a convenient narrative of the events unfolding in the world around us. Yet unless we stop to think about it, we are left with the impression that our conscious experiences reflect an instantaneous play-by-play account of reality.“
Quellen:
Buonomano Dean (2017), Your Brain Is a Time Machine
Buonomano, Dean (1965):
Neurowissenschaftler an der University of California, Los Angeles (UCLA)
Autor populärwissenschaftlicher Bücher
Stichworte:
Pluralität der Zeitvorstellungen, Multiple Clock Principle
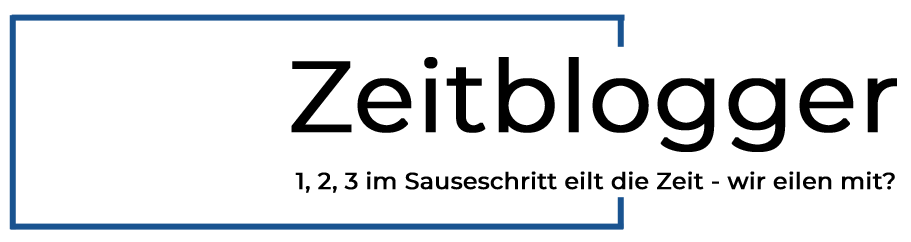
Schreibe einen Kommentar