Søren Kierkegaard
Nach Kierkegaard ist Zeitlichkeit ein Strukturmodus von Existenz, sie bildet den Horizont der existentialen Bestimmung des Menschen. Zeit ist für ihn ein wesentlicher konstitutiver Faktor für spezifisch menschliche Welt- und Selbstverhältnisse mit jeweils spezifischem Zeitverständnis, bestimmten existentiellen Grundeinstellungen und unterschiedlichen Möglichkeiten der Sinngebung.
Kierkegaard unterscheidet drei Existenzformen, die sich in der konkreten Lebenswirklichkeit überlagern bzw. in einander übergehen können. Der Ästhetiker bezieht seinen Lebenssinn aus den mannigfaltigen Anreizen der Welt, der Ethiker aus sich selbst (Entscheidung, Pflicht), der Religiöse aus seinem Verhältnis zu Gott, bzw. zum Absoluten. Jedem dieser Stadien korreliert ein entsprechendes Zeitlichkeitsverständnis.
Der Ästhetiker orientiert sich an der eigenen wechselhaften, spielerisch-phantasievollen sinnlichen Lust und Begierde. Kierkegaard unterscheidet den unreflektierten, von den Dingen seines Begehrens vollkommen ausgefüllten und den reflektierten, zu sich selbst in eine gewisse Distanz tretenden Ästhetiker. Ersterer lebt von Moment zu Moment, ohne einen inneren Zusammenhang. Seine Zeitlichkeit ist die einer bloßen Aneinanderreihung von Geschehnissen. Sein Zeitgefühl ist die Kurzweiligkeit. Letzterer beginnt, die Sukzession als Dauer zu erfahren, als unerwünschte Wiederkehr von immer gleichen Situationen. Sein Zeitgefühl ist die Langeweile, die er als inhaltslose Leere und lähmende Untätigkeit erfährt.
Für den gelangweilten Ästhetiker steht die Zeit still, sie ist nicht konstitutiv für seine existentielle Befindlichkeit. Zeit existiert nur in der Aufeinanderfolge einzelner disparater Momente. Die ästhetische Zeitlichkeit ist abstrakt und negativ, ohne Selbstbezug. Den Übergang zum Ethischen ermöglicht die Wendung auf sich selbst, auf die eigene Innerlichkeit (Immanenz). Den Übergangsmodus bildet die Ironie als negative Kraft, die sich gegen das Ästhetische selbst richtet und die mit einer tiefgreifenden Erschütterung, der Verzweiflung, einhergeht, die schlagartig das Verhältnis zu sich selbst umkehrt.
Der Ethiker entscheidet sich für ein selbstgesetztes Lebensziel und gewinnt daraus die absolute Freiheit, sein Leben selbst zu bestimmen. Das Selbst, das sich selbst wählt, ist ein endliches, geschichtliches Selbst, das Anlass und Verantwortung für eigenes Handeln (Pflichtgefühl) in sich selbst findet und sich immer neu bewähren muss. Ethiker sein, bedeutet, selbst werden und im Werden sich selbst zu bestätigen. Die stets neu zu treffende Wahl stattet ihn mit einer Geschichte aus. „In der Wiederholung vergewissert sich der Ethiker der Vergangenheit und macht sie fruchtbar für die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft.“ (Frischmann, S. 64) Wiederholung bedeutet keine bloße Wiederkehr von bereits Erlebtem, sondern eine immer neue Setzung des eigenen Selbst. Wiederholung zu wollen, erfordert den Mut, das gewählte Leben gutzuheißen und es so immer wieder zu wollen.
Der Religiöse greift über den immanenten Selbstbezug des Ethischen hinaus auf Transzendentes, wenn der Mensch über das ethisch selbst Gesetzte hinaus von etwas davon unabhängigem „Ent-setzlichen“ zutiefst erschüttert wird, das ihn in „Furcht und Zittern“ versetzt. Darin zeigt sich für Kierkegaard das Absolute (Gott), das auf eine eigentliche existentiale Verfasstheit des Subjekts verweist, die keiner rationalen Erklärung zugänglich ist, weil darin ein paradoxes Selbstverhältnis zum Ausdruck kommt, das mit einer charakteristischen Zeitlichkeit verbunden ist.
Das religiöse Zeitempfinden ist vom Ereignishaften geprägt, das plötzlich, unerwartet und ungeplant hereinbricht. Der nicht wiederholbare, diskontinuierliche Sprung führt in ein neues irrationales Selbstverhältnis, in dem sich der Mensch seiner Unzulänglichkeit bewusst wird, einer „Schuld“ zu entgehen, die er nicht gewollt und dennoch zu verantworten hat. Die Erfahrung des Betroffenseins von dieser Art der Schuld, diesen Zustand, beständig unabweisbaren Verfehlungen ausgesetzt zu sein, nennt Kierkegaard „Sünde“. Die ereignishafte Zeitlichkeit führt die unausgesetzte Unkontrollierbarkeit des Weltgeschehens und der Folgen eigenen Handelns vor Augen, denen sich der Mensch dennoch jederzeit verantwortlich stellen muss.
Das plötzlich eintretende erschütternde Ereignis, das den Selbstbezug auf das Transzendente initiiert, konstituiert (oder markiert) für Kierkegaard einen vorübergehenden Augenblick der Angst, einen Moment prinzipieller existentieller Verunsicherung, erfüllt von dem Bewusstsein, dem eigenen Dasein als einer Fülle von Möglichkeiten nie gerecht werden zu können (Sündenbewusstsein). Das Wesen der Existenz zeigt sich für Kierkegaard an dieser Stelle in der Erkenntnis von der Unmöglichkeit, die eigenen Möglichkeiten zu realisieren: zugleich zu können und nicht zu können.
Das jeweils konkrete, situationsgebundene Selbstverhältnis, die existentielle Dimension des Menschseins, fixiert die Beziehung zwischen Körper und Seele als vorübergehende Möglichkeit unter verschiedenen Aspekten aufeinander: als Zeitlichkeit und Ewigkeit, Notwendigkeit und Freiheit, Endlichkeit und Unendlichkeit (hb: geworden seiend und seiend, bestimmt und unbestimmt, begrenzt und unbegrenzt). Das Selbstverhältnis des Geistes (Selbst) zu sich selbst äußert sich in der Angst vor der freien Wahl der Möglichkeit, in Unkenntnis der Umstände und der Folgen etwas tun oder lassen zu können.
Die konkrete individuelle Erfahrung im Augenblick existentieller Verunsicherung geht einher mit einer existentiell bestimmten, individuellen Zeitlichkeit, die sich von einem abstrakten Verständnis von Zeit als bloßer Sukzession von belanglosen, austauschbaren Zeitmomenten unterscheidet. Es ist eine selbstbezogene Zeitlichkeit, die aus der konkreten Inbezugsetzung von Körper und Seele hervorgeht. Der Augenblick existentieller Verunsicherung ist kein Geschehen in der Zeit, sondern eine vom Selbst (Geist) her bestimmte Setzung von Zeitlichkeit.
Die Zeit sinnlichen Erlebens (des Körpers im anthropologischen Modell von Kierkegaard) entspricht als „unendliche Sukzession einem homogenen, unterschiedslosen Vorübergehen, in dem kein gegenwärtiger Moment identifiziert und festgehalten werden kann. Sie ist inhaltsleer und stets im Verschwinden begriffen. Die Zeit der Ewigkeit (der Seele) repräsentiert die Idee einer homogenen, unterschiedslosen Dauer, ein inhaltsüberfülltes Gegenwärtiges ohne Vergangenheit und Zukunft. Im existentiell erfahrenen Augenblick bezieht das Selbst (der Geist) Zeit und Ewigkeit aufeinander und unterbricht unendliche Sukzession und ewige Dauer durch die Markierung einer Gegenwart (Jetzt), die von einer Vergangenheit und einer Zukunft geschieden ist.
In den Worten von Bärbel Frischmann (S. 71): „Die Setzung des Augenblicks ist eine Leistung des Geistes, der aus der homogenen Sukzession der Zeit einen bestimmten, existentiell prägenden Moment heraushebt. Im Augenblick wird das existentiell Bedeutsame sichtbar und damit Zeitlichkeit als Konturierung des Selbstverhältnisses deutlich.“ Kierkegaard: „Der Augenblick ist jenes Zweideutige, in dem sich Zeit und Ewigkeit berühren, und damit ist der Begriff Zeitlichkeit gesetzt, wo die Zeit ständig die Ewigkeit abschneidet und die Ewigkeit ständig die Zeit durchdringt. Jetzt erst bekommt die erwähnte Einteilung ihre Bedeutung: die gegenwärtige Zeit, die vergangene Zeit, die zukünftige Zeit.“ (zitiert nach Frischmann, Der Begriff Angst, S. 105)
Auch die unreflektierte Alltagszeit unterscheidet ein Gestern, Heute und Morgen. Aber diese Bestimmungen sind äußerlich und wirken von außen auf das Subjekt. Dagegen erwächst die vom Augenblick her strukturierte Zeitlichkeit aus einer tiefen Innerlichkeit des subjektiven Daseins. Aus dem Moment existentieller Verunsicherung emergiert ein Sinnhorizont, in dem Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit neu ausgelegt werden. Der Vorblick in eine ungewisse Zukunft voller Möglichkeiten eröffnet einen Horizont für das Entwerfen der eigenen Existenz, aus dem heraus Gegenwart und Vergangenheit rückblickend neu bewertet werden. „Bei jeder Entscheidung bleibt die Frage, ob es die richtige war, wie das Leben verlaufen wäre, hätte man sich anders entschieden.“ (Frischmann, S. 75)
Quellen:
Frischmann, Bärbel, Existenz und Zeitlichkeit bei Søren Kierkegaard, in Die Realität der Zeit, Hg. Johann Kreuzer und Georg Mohr, Wilhelm Fink Verlag, 2007, S. 59-76
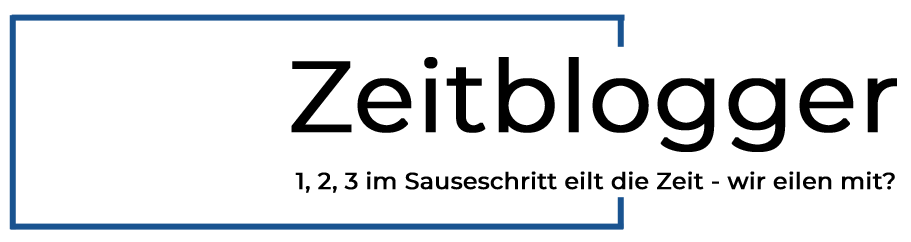
Schreibe einen Kommentar