Martin Heidegger
In „Sein und Zeit“ geht es Heidegger um eine phänomenologische Bestimmung des Seins aus dem Dasein des Menschen, das er als Weise des In-der-Welt-Seins analysiert. Zeit hat für ihn keinen gegenständlichen Charakter, sondern ist Erscheinungsweise des Seienden: Die Zeit ist kein Was, sondern ein Wie. Sein Ansatzpunkt ist eine zeitliche Analyse des Daseins, das er mit Anwesenheit und Gegenwärtigkeit (Präsenz) in Verbindung bringt.
Anknüpfend an Kierkegaard, Nitzsche und Dilthey und deren Herausstellung der historischen, von zufälligen Umständen geprägten Veränderlichkeit unseres Welt- und Selbstverständnisses, wendet Heidegger sich gegen die traditionelle Metaphysik, die mit ihrer Suche nach Urgründen und ewigen Gesetzen letzte Wahrheiten und determinierte Sicherheit bzw. absolute Kontrollierbarkeit anstrebt. Er richtet sein Interesse auf das konkrete Leben in seiner von Zufällen geprägten, historisch gewachsenen Tatsächlichkeit. Es geht ihm darum, das eigene Leben nicht zum Objekt zu machen und so als Ding aufzufassen, sondern den Lebensvollzug selbst in den Fokus zu rücken.
Seiendes im Allgemeinen und Leben insbesondere sind nicht bloß vorhandene isolierte Dinge, sondern in Weltbezüge eingebunden, deren Bedeutung sich erst vor einem zeitlichen Horizont erschließt. Heidegger verdeutlicht dies an Mittel-Zweck-Relationen, die nur in der zeitlichen Beschreibung der Verwendung verständlich werden. Es geht ihm aber nicht darum, die unverfügbare Zukunft durch Festlegungen oder Berechnungen verfügbar zu machen, sondern jederzeit offen und bereit zu bleiben für das plötzlich einbrechende Ereignis, das unmittelbar gelebte Leben. In zeitlicher Hinsicht geht es ihm darum, den Blick von der Verwendbarkeit der gewärtig vorhandenen Dinge weg und hin auf ihr Gewordensein und ihre zwar begrenzten, aber nicht vorherbestimmten Entwicklungsmöglichkeiten zu lenken.
Über Kants Bestimmung der Zeit als apriorische Form der Anschauung, durch die wir etwas als etwas im ‚Jetzt‘ fixieren können, hinaus, bestimmt Heidegger Zeit als existenziale Bedingung dafür, dass wir überhaupt eine Welt entwerfen und uns damit in einen Lebenszusammenhang stellen können, in dem dann sekundär auch die Erkenntnis von vorhandenen Gegenständen eine Rolle spielt. Was ein Ding im Allgemeinen und Leben insbesondere ist, kann also nach Heidegger nicht aus seinem gegenwärtigen Vorhandensein verstanden werden, sondern nur im sinnstiftenden Zusammenhang zeitlicher Weltbezüge. Erst dann, um Heideggers bekanntes Beispiel zu zitieren, wird aus einem Stück Holz und Eisen ein Hammer.
Weltentwurf und Lebenszusammenhang gehen aus einer temporalen Doppelbewegung hervor, die sich bezogen auf die Gegenwart in einem Vorlaufen in eine unbestimmte, aber endliche Zukunft und einem Zurückkommen aus einer Vergangenheit/Gewesenheit, das die Offenheit für die begegnende Welt prägt, vollzieht.
Für Heidegger begrenzt der Tod das Leben nicht einfach in einem abschließenden, beendenden Sinn nach dem Durchlaufen der Lebenszeit, sondern das Wissen um die eigene Sterblichkeit durchzieht nach seiner Auffassung als Grenzwissen ausgesprochen oder unausgesprochen das ganze Leben (Sein zum Tode) und prägt das Dasein in seiner existenziellen Einstellung. Wenn der Mensch nicht sterben müsste, fiele nicht bloß das Lebensende weg, sondern sein ganzes Leben erhielte einen anderen Charakter. Damit wirkt der in der Zukunft liegende unbestimmte Tod bereits in der Gegenwart. Es gibt eine Rückbezogenheit der Zukunft auf die Gegenwart. In dem Auf-den-Menschen-Zukommen der letzten Möglichkeit des Todes sieht Heidegger das ursprüngliche Phänomen der Zukunft.
Auch Vergangenheit wirkt in die Gegenwart hinein. Heidegger spricht von „Gewesenheit“ und verweist damit auf die Akzeptanz der Geworfenheit des Menschen, das Faktum, dass er sich nicht selbst setzt oder schafft, sondern als Mensch immer schon ist, was er geworden ist. Die Vergangenheit ist kein tragendes Fundament, sondern das in die gegenwärtige menschliche Verfasstheit Hineinzwängende und die Seinsmöglichkeiten Beengende.
Zeitlichkeit ist für Heidegger die Einheit von Zukunft, Gewesenheit und Gegenwart (der Sorge ermöglichende Sinn der Existenz). „Die Zeitlichkeit ist eine zusammenfassende Charakterisierung der Endlichkeit sowie eine Betonung der gleichzeitigen Offenheit der Existenz gegenüber dem in der Vergangenheit Geschehenen, dem gegenwärtig Begegnenden und den zukünftigen Möglichkeiten. Mit der Geschichtlichkeit wird der Mensch als ein wiederholendes Wesen freigelegt, welches die Möglichkeiten seiner Existenz nur durch verinnerlichte Aneignung des historischen Erbes erreichen kann.“ (Stegmüller, S. 157)
Die radikale Erfahrung der eigenen Endlichkeit, die mit einer Grunderfahrung der Angst vor dem Selbstsein und dem Nicht-Sein-Können einhergeht, ermöglicht nach Heideggers Auffassung eine „eigentliche“ Existenz und eröffnet den Horizont der vielfältigen Möglichkeiten unseres alltäglichen Daseins. Sein und Zeit erschließen sich aus der Tiefendimension eines „Es gibt“, das als grundlegend unbestimmter Möglichkeitsraum konzipiert ist, aus dem heraus sich erst Wirklichkeit im Sinne eines konkreten Seins mit einer konkreten Zeitlichkeit kristallisiert.
Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit sind für Heidegger Zeitigungsmodi (Ekstasen) der Zeitlichkeit. Im uneigentlichen Sein in der Welt schrumpft die Spannung zwischen Vergangenheit und Zukunft auf ein Minimum und der Mensch verliert sich im Alltäglichen. Erst in der eigentlichen Existenz kommt diese Spannung voll zum Tragen. Die spezifischen Kennzeichen der eigentlichen, zeitlich entfalteten Existenz des Menschen sind bei Heidegger die Stimmung der Angst, das Erlebnis der Schuld, das Hören des Gewissensrufes, das Sichgewinnen-und-Sichverlieren-Können, das Sterben und die Aneignung des geschichtlich Überlieferten.
In der von Heidegger existenzial bestimmten, eigentlichen Zeitlichkeit sind Vergangenheit und Gegenwart von der Zukunft und dem entschlossenen, vorausgreifenden Wissen um die eigene Sterblichkeit bestimmt. Dem stellt Heidegger den alltagspraktischen Normalfall der uneigentlichen Zeitlichkeit gegenüber, in der wir das Wissen um die Sterblichkeit ausblenden und die Zukunft und Vergangenheit von unseren gegenwärtigen Bedürfnissen und Interessen bestimmt werden. In den praktischen Zusammenhängen des Alltags erscheint die Zeit als eine in die alltäglichen Besorgungen eingebaute und von diesen her bestimmte „Weltzeit“.
Während in der als defizitär aufgefassten uneigentlichen Zeitlichkeit dennoch etwas von der ekstatischen Verfasstheit der eigentlichen Zeitlichkeit zu spüren bleibt, ist dieser ekstatische Bezug in der von Heidegger als vulgär bezeichneten Zeitlichkeit völlig ausgeblendet. Die Zeit wird zu einer gegenständlich gewordenen äußeren Zeitmacht, einer reinen Jetztfolge, in der Termine regieren und der man immer nur hinterher rennt. Die vergegenständlichte Zeit verfließt unter den Händen. Jede eingesparte Zeit drängt sich sofort als leere, also erneut mit Arbeit auszufüllende Zeit auf. In den Worten von Mike Sandbothe: „Es sind nicht mehr die konkreten Besorgungen und Bedürfnisse, die den Zeitplan bestimmen, sondern es ist die leere Zeit selbst, die neue Bedürfnisse erweckt und ihre eigene Kapitalisierung erzwingt.“
Die unendliche gemessene Zeit ist aus der eigentlichen endlichen Zeitlichkeit abgeleitet und sekundär. Sie hat öffentlichen Charakter und ist den auf ihre Vorhandenheit reduzierten Begebenheiten in der Welt als selbst etwas bloß Vorhandenes zugeordnet, nivelliert als „lückenlose, gleichgültige Aufeinanderfolge qualitativ indifferenter vorhandener Jetztpunkte“ (Stegmüller).
Heidegger unterscheidet also drei Formen von Zeitlichkeit, die nach Sandbothe eine Weiterführung der von Kant angebahnten Verzeitlichung der Zeit unter den konkreten Bedingungen des menschlichen In-der-Welt-seins darstellt: die fundamentale, mit Zukunftssorge befasste eigentliche Zeitlichkeit, die gegenwartszentrierte, praktisch orientierte uneigentliche Zeitlichkeit und die lineare vulgäre Zeitlichkeit.
Der Mensch ist nicht zeitlich, weil er im Fluss der Zeit steht, sondern weil die Zeitlichkeit seinen innersten Wesenskern ausmacht. Ebenso ist er nicht geschichtlich, weil er in den objektiven Ablauf der Weltgeschichte eingebunden ist, sondern weil das Dasein als solches durch Geschichtlichkeit konstituiert wird. Heidegger setzt konsequent die Priorität auf das Subjektive vor das Objektive. Die Möglichkeiten, die der Mensch ergreifen kann, entstammen nach Heidegger dem angeeigneten überlieferten Erbe. Er ist ein für die Zukunft offenes, Vergangenes wiederholendes Wesen. Menschliches Handeln erhält nicht aus einem vermeintlich objektiv gewussten Sinnzusammenhang der Geschichte geschichtlichen Sinn, sondern indem es sich zurückbezieht auf die individuelle Einmaligkeit des Gewesenen und darauf reagierend „in das noch unentschiedene Dunkel der Zukunft vorstößt“ (Stegmüller).
Während der frühe Heidegger die temporalen Grundstrukturen mit dem Dasein verbindet, setzt der späte Heidegger die temporalen Grundstrukturen in Zusammenhang mit dem Sein. Dabei tritt der „Vorrang der Zukunft“ hinter „die Einheit der drei Dimensionen der eigentlichen Zeit“ zurück, die jetzt als gleichberechtiger „Wechselbezug“ gedacht wird. Die Temporalität des Seins wird nicht mehr als letzte Fundierungsdimension konzipiert, sondern als ein Geschehen (Ereignis), das sich auch anders vollziehen kann, d.h. einer historisch-kulturellen Veränderung prinzipiell offensteht.
Die verschiedenartigen Bestimmungen des Seins in der Metaphysik bringen Heidegger zu dem Schluss, dass das Sein selbst eine Geschichte hat. Seine Wende zur Seinsgeschichte als Geschichte der Verdeckung des ursprünglichen (noch authentischen) Seinsverständnisses bezeichnet er als „Kehre“. Dabei geht es nicht um eine Überwindung der Metaphysik, sondern um eine „Verwindung“, weil er im Rückgang auf die ersten Anfänge mit dem ursprünglichen, vormetaphysischen Seinsverständnis und einem lernenden Verständnis für dessen metaphysische Überprägungen einen „anderen“ Anfang aufdecken will.
Den angestrebten Übergang vom ersten zum anderen Anfang zeichnet Heidegger als Sprung in ein eigentliches seinsgeschichtliches Denken aus, in dem nicht das Sein als definierbare Gegebenheit, sondern ein nicht verfügbarer geschichtlicher Prozess des Ver- und Entbergens der Seinserfahrung thematisiert wird, durch den sich Welt epochal als Bedeutungsganzheit ereignet und von woher sich dann bestimmt, was wesentlich und was unwesentlich ist, was ist und was nicht ist. In Heideggers Rede vom Ereignis, von Seinsgeschick und Seinsentzug kommt zum Ausdruck, dass der Mensch in ein Überlieferungsgeschehen eingebunden ist, über das er nicht einfach disponieren kann, sondern das ihn in gewisser Weise disponiert.
Quellen:
Böhler, Arno, in 6. Vorlesung GesmbH (0:56:50), gehalten mit Manfred Füllsack an der Uni Wien
Poller, Horst, Die Philosophen und ihre Kerngedanken, München Olzog Verlag, 2. Auflg. 2007 S. 428
Sandbothe, Mike, Die Verzeitlichung der Zeit in der modernen Philosophie unter Rückbezug auf Kant und Heidegger, erschienen in: Die Wiederentdeckung der Zeit, hrsg. von Antje Gimmler, Mike Sandbothe und Walther Ch. Zimmerli, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1997
Sandbothe, Mike, Stichwort: Zeit – Von der Grundverfassung des Daseins zur Vielfalt der Zeit-Sprachspiele, in Heidegger-Handbuch, Hg. Dieter Thomä, Stuttgart: Metzler 2003, 87-92
Stegemüller, Wolfgang, Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie, Bd. 1, 7. Auflage, Alfred Kröner Verlag 1989, 135-177
Wikpedia-Artikel zu Martin Heidegger in der Version vom 21.12.2024, mit starken Bezügen auf Rainer Thurnher: Martin Heidegger. In: Heinrich Schmidinger, Wolfgang Röd, Rainer Thurnher: Geschichte der Philosophie. Band XIII, München 2002
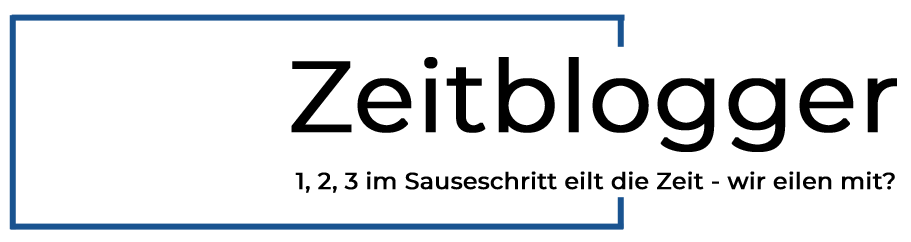
Schreibe einen Kommentar